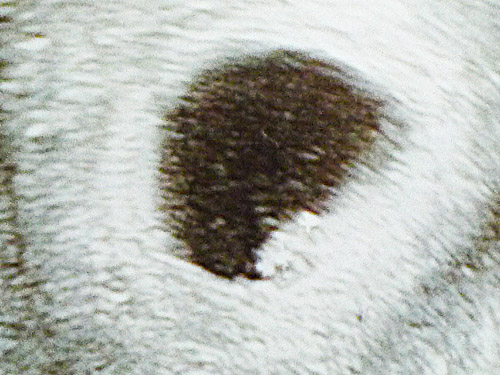Bild: gepflegte deutsche Grabsteine an der Kirche von Jetrichovice (früher Dittersbach, in der böhmischen Schweiz)
Von Mathias Kretschmer (Vorsitzender KA Sachsen)
Nachdem, für mich sehr ergreifenden, Hirtenbrief von Seiner Excellenz Bischof Dr. Stanislav Přibyl, CSsR zum Jahresende 2025 befasse ich mich diesmal intensiv mit dem Thema Versöhnung. Warum? Sie, die Versöhnung, kam auf mich zu, um Teil von ihr zu werden. Nachdem ich den Hirtenbrief gelesen hatte, wurde ich nachdenklich.
Ich bin Nachgeborener, also ein Sohn von Vertriebenen, nicht aus dem Sudetenland, sondern aus der Grafschaft Glatz. Oft bereisten meine Frau (ebenso wie ich Kind von Vertriebenen aus der Grafschaft Glatz) diese wunderbare Gegend die Heimat unserer Eltern. Was auch hier in jener Zeit passierte, ist ebenso wie im Sudetenland mit Worten kaum zu beschreiben. Es ist nicht so, dass das Grauen der Nationalsozialisten mit all seinen Folgen vorbei war es änderte mit den Kommunisten meiner Ansicht nach nur das Aussehen und plötzlich lebten wir in der Folgediktatur. Was war bloß los mit den Deutschen? Und was bewegt uns heute, wenn wir auf diese Zeiten schauen? Wie geht es weiter -kann ich- können wir versöhnen?
Sie kam auf mich zu, die Versöhnung, erst in einem kleinen Kommentar auf Facebook unter dem Post mit dem Hirtenbrief des Bischofs. Dann kam der direkte Kontakt von Frau Bellmann auch über das Internet zu mir. Sie schilderte mir wie sie im hohen Alter immer noch mit den Situationen ihrer Vergangenheit ein nicht zu unterschätzendes Problem hat. Sie kann nicht abschließen, gedemütigt, vertrieben, Schuld mit sich tragen, keine Chance zu haben, sie ist sozusagen ihre eigene Heimat los. Genau darum geht es dem Bischof. Sagt was damals los war, es war so, was nun? Ich schrieb ihr mit dem Bischof Kontakt aufzunehmen und bot ihr an auch gemeinsam zu ihm reisen. Sie bat mich aufgrund ihres hohen Alters (89 Jahre) stellvertretend für sie den Kontakt mit ihm aufzunehmen, eine Reise traue sie sich nicht mehr zu. So schrieb sie mir ihre dramatischen und traurigen Erlebnisse stumpf und ohne Hoffnung, die bis heute in ihr nicht zur Ruhe kommen. Nicht im Bösen, einfach nur im Unverständnis.
Mich hat dies verstärkt ihr beistehen zu wollen, Hoffnung zu schenken, Versöhnung zu versuchen und so schrieb ich einen Brief mit meinen Worten und ihren Erlebnissen per Email an den Bischof von Leitmeritz. Schon am nächsten Tag 14.01.2026 kam die Antwort des Bischofs an mich mit der Bitte diese an Frau Bellmann weiterzuleiten. Dies tat ich so gern und voller Freude. Frau Bellmann dankte mir sehr dafür. Sie hat wahrscheinlich nicht mit diesem Bischof gerechnet. Plötzlich war sie da die Versöhnung, ich war Teil davon und der Bischof sorgte mit der Gnade Gottes dafür, dass Menschen loslassen dürfen und wir Katholiken können dies und müssen es tun. Ballast abgeben einfach bitten und tun mit der Freude auf das, was nun kommt. Vielleicht begegnen sich diese drei Menschen mit Gott in der hoffentlich sehr gut besuchten Versöhnungsmesse im Böhmisch-Kamnitz am 17. Oktober 2026 um 10 Uhr. Dort ist die Heimat von Frau Bellmann und der Bischof wird ihre Erlebnisse vortragen und im Kirchenarchiv aufbewahren.
Kann man dies einfach so veröffentlichen? Ich denke ich muss dies tun, um der Generation von Frau Bellmann und auch uns Nachgeborenen diesen Weg zu zeigen. Sie und uns aufzurufen, wachzurütteln, ja zu bitten, das Angebot des Bischofs anzunehmen. Versöhnung, Erleichterung, die Gnade abschließen zu dürfen, um wieder geistig frei sein zu können.
Was ist Versöhnung – wenn der Weg der Versöhnung gegangen wird – erlebt man die Gnade Gottes einfach für sich und andere. Danke, dass ich dies erleben durfte.
Dokumentation des Email-Wechsels:
Email von Frau Bellmann an M. Kretschmer
Sehr geehrter Herr Kretschmer,
vielen Dank für Ihre schnelle Rückantwort. Ich bin jetzt 89 Jahre alt u. traue mir die lange Reise nach Leitmeritz nicht mehr zu. Ich war mit meinen damals noch lebenden Eltern in der einstigen Heimat. Wir wohnten in Böhmisch-Kamnitz (heute Ceska-Kamenice). Als wir vor unserem Elternhaus auf der Straße standen, hetzte der im Haus lebende Tscheche den Schäferhund auf uns, er fürchtete wohl, die Deutschen würden wiederkommen. Meine Eltern hatte ich bis damals noch nie so völlig aufgeregt gesehen. Wir wurden am 2.12.1945 (es war mein 8. Geburtstag) aus diesem Haus vertrieben. Bei uns waren die Großeltern u. mein Bruder (inzwischen verstorben). Unser Vater war im 2. Weltkrieg in Gefangenschaft. Mir wurde mit dem Gewehrkolben in die Beine geschlagen, da ich die 3 Stufen des Einganges nicht schnell genug herunterkam. Auf dem Weg nach Tetschen-Bodenbach wurde meinem Spielfreund (damals wohl 9 Jahre alt) in den Kopf geschossen, er stürzte und ging in einem kleinen Bächlein unter. Mir bleiben dessen schwarze Haare im Gedächtnis. Meinem Vater versprach ich auf dessen Sterbebett, dass er neben seinem Vater auf dem Heimatfriedhof beerdigt werde. Leider gestatteten dies die tschechischen Behörden im Jahre 1980 nicht und ich hatte jedes Mal ein schlechtes Gefühl, wenn ich hier vor dem Grabstein stand. Die Ereignisse rund um die Vertreibung belasten mich noch heute, besonders an meinem Geburtstag (2.12.1937) kommen sie mit Macht wieder hoch. Ich versuche zwar, das Vergangene ruhen zu lassen, leider gelingt es mir nicht. Ich habe Ihnen meine Kindheitserlebnisse geschildert, die mich bis ins hohe Alter verfolgen. Sie können diese gerne verwenden, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet.
Herzlichen Dank für Ihr Mitgefühl sagt Ihnen Gertrud Bellmann geborene Wenzel, früher wohnhaft Böhmisch-Kamnitz, Hillemühler Strasse 555.
Dieses Schreiben wurde an Bischof Přibyl weitergeleitet:
Seine Excellenz Bischof Stanislav Přibyl,
ich habe durch die sozialen Medien von Ihrem Hirtenbrief Weihnachten 2025 gelesen. Inhaltlich berühren mich ihre Worte zutiefst. Meine Frau und ich sind Kinder von Vertrieben aus der Grafschaft Glatz in Polen. Sie wagen einen großen Schritt zu gehen, um zu versöhnen. Was damals geschah ist an beiderseitigem Leid kaum zu beschreiben. Was war in die Deutschen gefahren? – frage ich mich selbst. Nach den Nationalsozialisten kamen die Kommunisten – und wieder diese Frage: Was war in diese Deutschen gefahren?
Zwei Diktaturen in so kurzer Zeit – nicht gut für Deutschland und gar nicht gut für unsere Nachbarn. Wie haben Sie dies erlebt? Mir hat der Glauben geholfen, um mit den Kommunisten zu leben aber auch um sie zu entmachten. Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 hat mich ebenso geprägt wie die Repressalien der Kommunisten und die Vertreibung meiner Eltern.
Ich bin sehr gespannt, ja fast schon aufgeregt wie ihre Gespräche, nach ihrer mutigen Aufforderung zur Versöhnung beginnen, weitergehen und schaffen Sie es mit der Gnade Gottes zu versöhnen. Ich persönlich kann mir nichts Schöneres, nichts Gewaltigeres als diese Versöhnung vorstellen. Ich kann Sie und die Menschen in Ihrem Land und dem Bistum als Deutscher Katholik nur bitten diesen Weg zu gehen. Aus all dem Groll, dem Hass, der Wut und der immer wiederkommenden Enttäuschungen, dem Misstrauen aus guten Gründen den Weg hinaus in eine neue Ära gemeinsam im Glauben an Gott zu gehen.
Nach einem kurzen Gespräch hat mich ein Leserbrief erreicht, wo Frau Bellmann ihre Vertreibung aus dem Sudetenland beschreibt und wie sie dies bis heute belastet. Ich schlug ihr vor mit Ihnen das persönliche Gespräch zu suchen. Frau Bellmann bat mich, aufgrund von ihrem Alter 89 Jahre, den Kontakt aufzunehmen. und um ein persönliches Gespräch bei Ihnen zu diesem Thema zu bitten. Ich bin leider nur der deutschen Sprache mächtig.
Antwort von Bischof Dr. Stanislav Přibyl, CSsR
Sehr geehrter Herr Kretschmer,
ich bedanke mich für Ihre E-Mail und für den Brief von Frau Gertrud Bellmann, in dem sie ihre Erinnerungen an die Vertreibung und die unangenehme Begegnung nach vielen Jahren schildert. Ich danke ihr für ihr Zeugnis, das wir in unserem Archiv aufbewahren werden. In Böhmisch-Kamnitz werden wir am 17. Oktober 2026 um 10 Uhr einen Versöhnungsgottesdienst abhalten.
Ich werde ihr Zeugnis im Rahmen dieses Gottesdienstes vorlesen lassen.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Frau Bellmann meine E-Mail mit einem Dankeschön und der Zusicherung meiner Gebete weiterleiten könnten.
Ich verstehe Versöhnung als einen Weg nach vorne. Es ist ein Werk, das niemals vollendet ist. Ich verstehe es weder als Revision der Geschichte noch als politisches Gestus, sondern lediglich als Heilmittel für alte und frische Wunden, das vor allem wir Christen bringen können und müssen.
Mit herzlichen Grüßen
Dr. Stanislav Přibyl, CSsR
Bischof von Leitmeritz Biskupství litoměřické